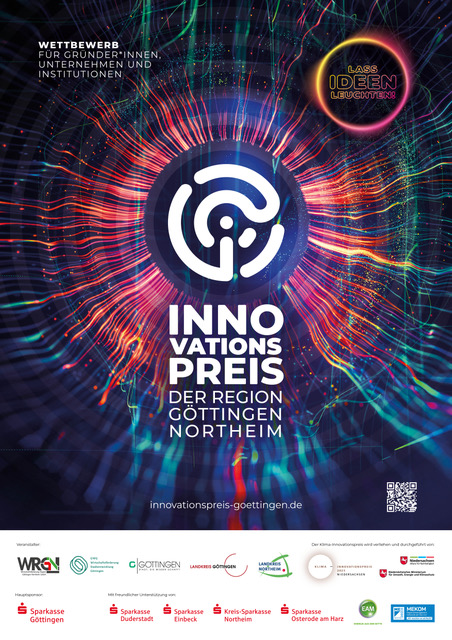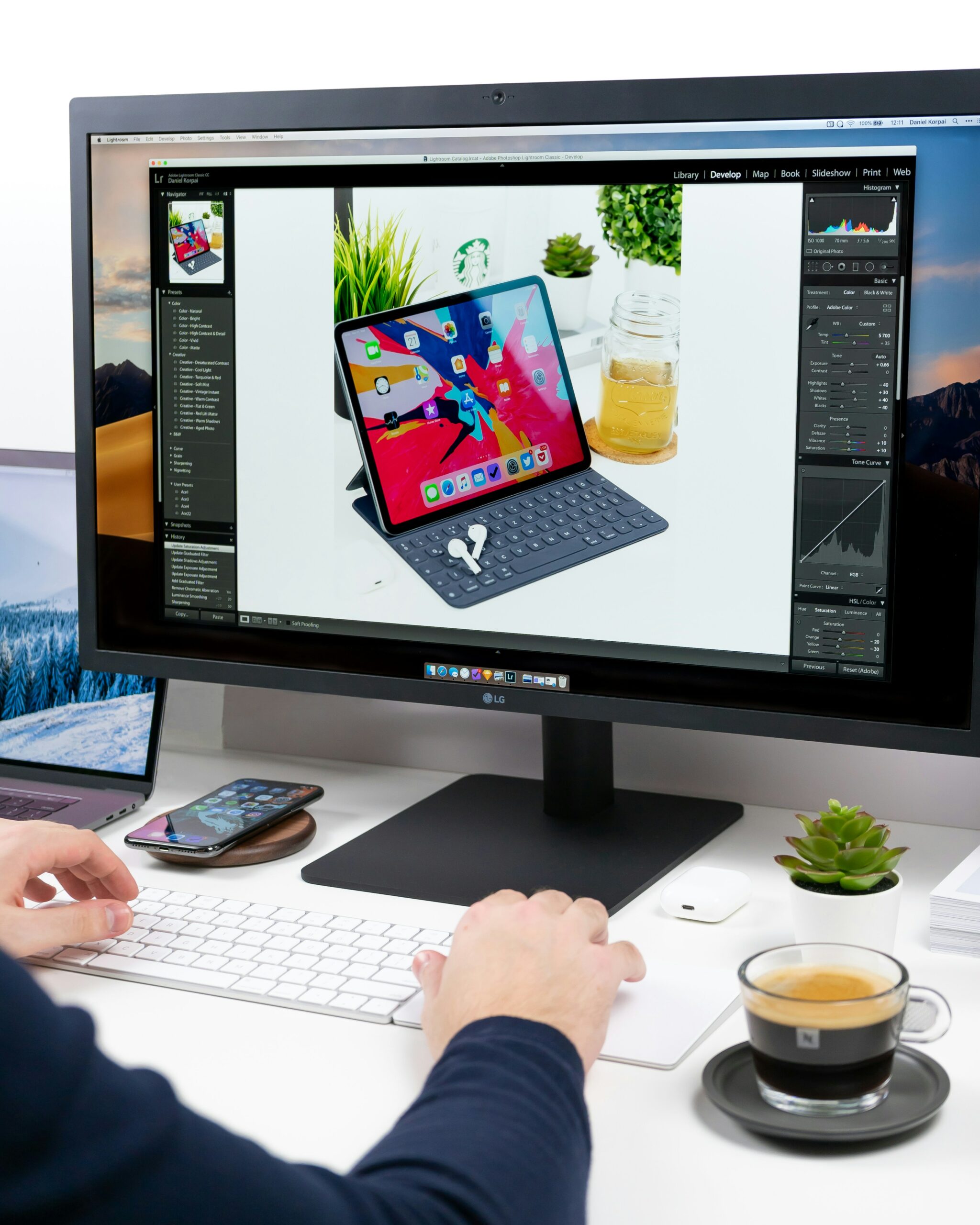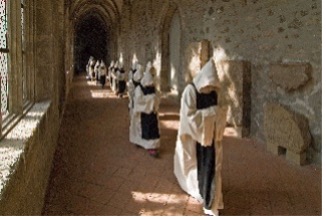Urlaubsregion Teutoburger Wald
Bielefeld, 27.08.2025. Der Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH präsentiert eine positive Entwicklung der Übernachtungszahlen im ersten Halbjahr 2025. Mit insgesamt über 3,2 Millionen Übernachtungen verzeichnet die Region eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
Wachstum in der Urlaubsregion
Laut der amtlichen Statistik von IT.NRW wurden von Januar bis Juni 2025 exakt 3.262.842 Übernachtungen in der Urlaubsregion Teutoburger Wald gezählt, was einen Anstieg um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Zudem stieg die Zahl der Ankünfte um 2,8 Prozent auf 985.128. Diese Ergebnisse verdeutlichen den positiven Trend im Tourismus der Region.
Die Nummer 3 in NRW
Mit diesen Übernachtungszahlen festigt die Region ihre Rolle als drittstärkste Tourismusregion in Nordrhein-Westfalen, hinter Köln mit dem Rhein-Erft-Kreis sowie dem Ruhrgebiet. Das Bundesland NRW insgesamt verzeichnete über 26 Millionen Übernachtungen, jedoch mit einem leichten Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zu 2024.
Ausgebaute Kapazitäten und Qualität als Erfolgsfaktoren
Ein Zuwachs im Bettenangebot trug zur positiven Bilanz bei. Mit 38.745 angebotenen Betten insgesamt wird sogar das Vor-Corona-Niveau von 2019 um 741 Betten übertroffen. Markus Backes, Leiter des Teutoburger Wald Tourismus der OWL GmbH, stellt klar: „Neben der gestiegenen Bettenkapazität ist Qualität entscheidend. Qualitativ hochwertige und preislich attraktiven Angebote sorgen für nachhaltiges Wachstum in der Region.“
Herausforderungen und Chancen
In der positiver Gesamttendenz kommen eine Reihe von Einzelentwicklungen zusammen. Eine um 0,1 Prozentpunkte leicht gesunkene durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 3,3 Übernachtungen pro Ankunft, die steigende Zahl ausländischer Gäste und die Wirkung attraktiver Veranstaltungen etwa in Städten wie Gütersloh, Bielefeld u.a. tragen zum Gesamtergebnis bei.
Noch nicht in den vorliegenden Halbjahresergebnissen enthalten, sind die gerade zu Ende gehenden Sommerferien. Auch vor dem Hintergrund von immer kurzfristiger getätigten Buchungen, wird nicht zuletzt das Wetter Auswirkungen auf der Gesamtjahresergebnis haben. Alle Angaben der amtlichen Tourismusstatistik beziehen sich auf geöffnete Beherbergungsbetriebe, die im Berichtszeitraum mindestens zehn Gästebetten bzw. Stellplätze angeboten hatten.
Text / Bild: OstWestfalenLippe GmbH